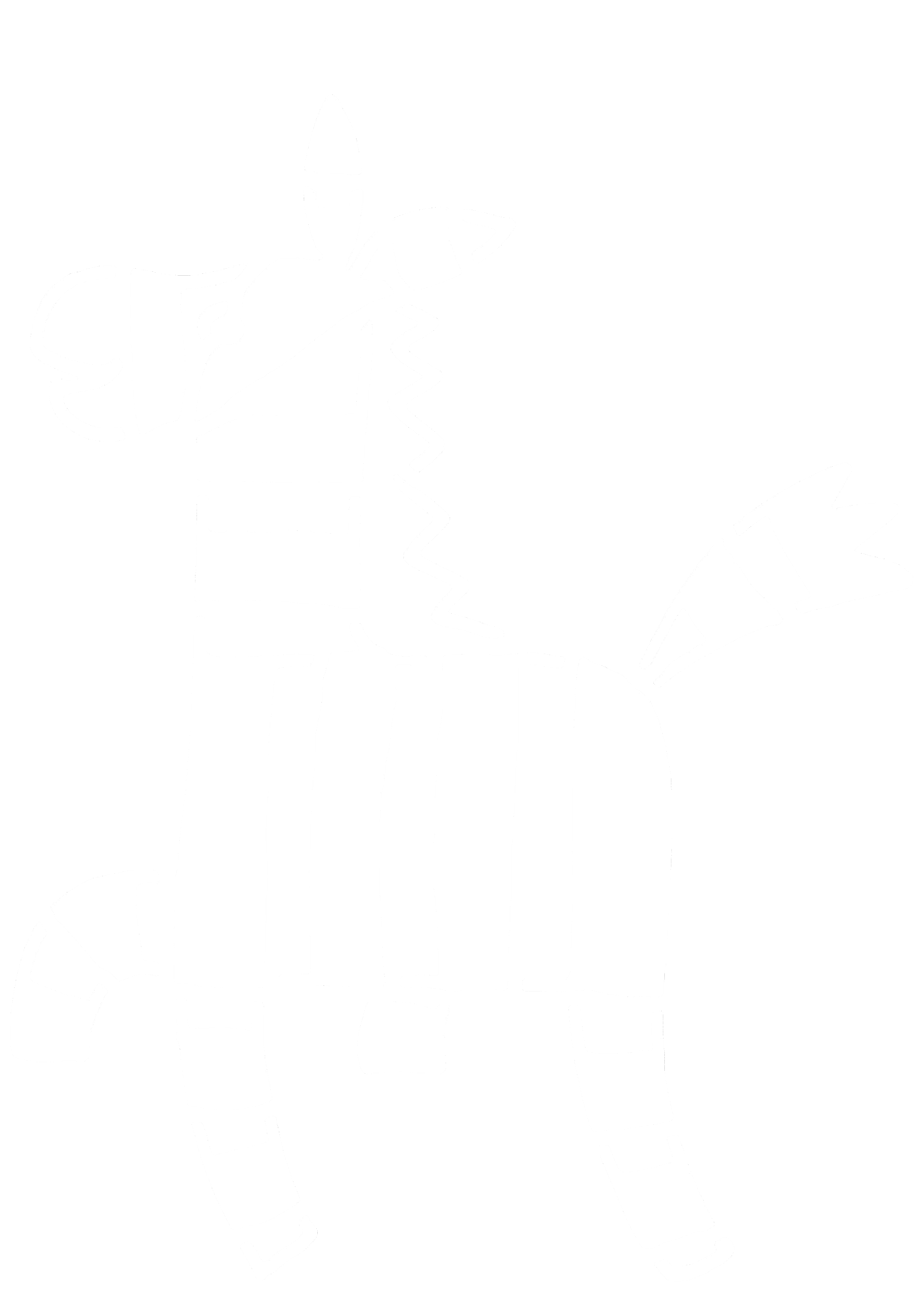Seit 2022 gilt in der EU eine Weidepflicht für Bio-Betriebe. Was gut gemeint ist – mehr Tierwohl, mehr Biodiversität – bringt auch Herausforderungen. Ein Besuch bei Bio- Bauer Sebastian Widhammer in Berbling zeigt: Es geht. Aber nicht von allein.
Zwischen EU-Vorgabe und Berblinger Forstweg
Weidehaltung – das klingt nach saftigen Wiesen, glücklichen Kühen und heiler Welt. Und: Seit der Reform der EU-Öko-Verordnung 2018/848 ist sie für Bio-Rinderhaltung verpflichtend. Deutschland hat das 2022 ins nationale Recht übernommen. Für Bio-Bauern bedeutet das konkret: Ihre Kühe müssen „bei geeigneter Witterung“ auf die Weide. Klingt einfach – ist es aber nicht.
In der Praxis ist die neue Pflicht eine Art Zäsur. Denn sie erfordert Infrastruktur, Zeit und Know-how. Wer, wie Sebastian Widhammer aus Berbling, 50 Milchkühe und 45 Stück Nachzucht hält, weiß, wovon er spricht: „Letztes Jahr hätt’ ich’s mir ehrlich nicht vorstellen können“, sagt er – heute ist es Alltag. Ein Weg durchs Holz zur Weide, Melkzeiten neu getaktet, Reinigungspläne angepasst. Und: Kuhfladen auf der Weide. Klingt unappetitlich, ist aber ökologisch wertvoll.
Die Freude der Kühe und das Zwitschern der Vögel
„Die Kühe haben richtig Gaudi, wenn’s auf d’ Weide geht“, erzählt Widhammer. Anfangs war er skeptisch – ob die Tiere freiwillig durch den Wald laufen? Ob das überhaupt praktikabel ist? Heute weiß er: Es funktioniert. Nicht reibungslos – ein paar Ausreißer gibt’s immer – aber mit erkennbarem Nutzen. Für die Tiere, für die Biodiversität, für den Boden.
Die Effekte sind messbar – im Kleinen wie im Großen. Die Kühe bewegen sich mehr, haben weniger Stress, sind fruchtbarer. Fliegenbelastung im Stall? Spürbar reduziert. Auf den Weiden blühen mehr Kräuter, Insekten tummeln sich – und Vögel finden Nahrung. „Ein schöner Nebeneffekt“, sagt Widhammer. Und trifft damit den Kern: Es geht nicht nur ums Tierwohl, sondern ums Ganze.
Bio heißt: Mehr als nur grüne Wiese
Die Weidepflicht ist nur ein Aspekt der Bio-Tierhaltung. Kein Kunstdünger, kein chemischer Pflanzenschutz, strenge Vorschriften bei Arzneimitteln, Bio-Futter, Dokumentationspflicht, Kontrollen – das alles gehört dazu. Und macht die Unterschiede zur konventionellen Landwirtschaft deutlicher als manch einer denkt.
Trotzdem: Auch im Konventionellen gibt’s Weidehaltung, auch dort sind Tierhalter engagiert. Pauschalurteile helfen nicht weiter. Aber: Bio setzt Standards. Und gerade weil die Anforderungen hoch sind, braucht es politische Unterstützung – nicht mehr.
Pflicht geblieben, Förderung gestrichen?
Hier liegt der Knackpunkt. Die Weidepflicht kam – die Förderung wurde gestrichen. „Immer das gleiche: Erst gibt’s freiwillige Programme mit Zuschuss, dann wird’s Pflicht und die Förderung fällt weg“, kritisiert Widhammer. Verständlich. Denn Weidehaltung braucht Präsenz. Und Präsenz kostet Zeit – vor allem bei kleinen Betrieben im Nebenerwerb.
Was helfen würde? Eine Agrarpo-litik, die Betriebsgröße, Arbeitsauf-wand und ökologische Wirkung einbezieht. Kein pauschales „pro Hektar“, sondern gestaffelte Prämien. Sonst profitieren Verpächter – und die Bauern haben das Nachsehen.
Zwischen Stall und Politik: Die Kuh als Klimaschützerin
Dabei hätte die Weidehaltung durchaus das Zeug zum Vorbild. Eine Studie zu wilden Wisenten in Osteuropa zeigt: Beweidung kann CO2 binden – vergleichbar mit den Emissionen von 40.000 Autos. Auch wenn Milchkühe keine Wildrinder sind: Das Prinzip bleibt. Und es passt gut nach Bad Aibling, wo Landwirtschaft, Moor- und Wiesenlandschaft ineinandergreifen.
Die Botschaft: Die Kuh auf der Weide ist kein nostalgisches Bild, sondern ein Baustein für zukunftsfähige Landwirtschaft. Doch dafür braucht’s Rückhalt – politisch, finanziell, gesellschaftlich.
Am Ende bleibt die Frage: Wenn schon Pflicht – warum nicht mit echter Unterstützung? Und warum nicht gemeinsam überlegen, wie wir die Weidehaltung als Chance für Tier, Natur und Region nutzen können? Sebastian Widhammer hat’s probiert – mit Mut, Pragmatismus und einem offenen Ohr für seine Kühe. Vielleicht braucht es davon einfach ein bisschen mehr.
Martina Thalmayr